|
| ||
|
Reiseführer aus dem Niemandsland Eine kurze Reise um einige Probleme der deutschen Gegenwartsliteratur
Indem ich mich in das Gespräch über literarische Strömungen der Gegenwart einschalte, und einige Fäden weiter spinne, möchte ich zugleich das Augenmerk auf interessante Fragestellungen richten, die das Bild zweier bereits vorgestellten Autorinnen weiter nuancieren. Es geht auch bei mir um Texte von Terézia Mora und Yoko Tawada, die aus dem Aspekt der Medialität im vorigen Band von Edina Sándorfi bereits dargestellt worden sind. Ich habe oben bewusst die weibliche Form 'Autorinnen' benutzt, jedoch liegt der Akzent meiner Untersuchung nicht auf der Kategorie weiblichen Schreibens, vielmehr werden im folgenden Fragen anvisiert, die den Kontext in Richtung interkulturelle Literatur öffnen. Es wird in meinem Essay um Neukömmlinge gehen, Interaktionen von Sprachen und Kulturen werden untersucht, und es werden dazu unterschiedliche Diskurse aktiviert: Ich werfe im Laufe meiner Ausführungen einen Blick auf einige neuere Tendenzen der Literaturgeschichte und auf die Problematik der Nationalliteratur.
Innerhalb der deutschsprachigen Literatur ist die Frage nach Zentrum vs. Peripherie nie besonders relevant gewesen, denn es gab traditionell keine eindeutigen Zentren. Auch heute sieht die Situation ähnlich aus, denn die Forschung spricht von einer deutschsprachigen, und innerhalb dieser Kategorie von einer deutschen, österreichischen und Schweizer Literatur. Dazu kommt noch, dass zahlreiche deutschsprachige Autoren nicht im deutschen Sprachraum leben, sondern zu einer Minderheit gehören (zum Beispiel in Ost-Europa). Hier ist die Frage nach Zentrum und Peripherie bereits angemessen, denn diese Literaturen sind eher Randliteraturen. Vom Rande, von der Peripherie kommen auch die Autorinnen, mit denen ich mich hier befasse: Terézia Mora aus Ungarn und Yoko Tawada aus Japan.
Beide sind Migranten, die nach ihren literarischen Erfolgen seit den achtziger und neunziger Jahren im Zentrum des deutschen literarischen Lebens stehen, mehrfach mit Preisen dotiert sind, und bereits zum Kanon innerhalb der so genannten 'jungen deutschen Literatur' gehören. Diese Dichotomie, die aus der ursprünglichen Fremdheit und der geänderten gegenwärtigen Situation resultiert, stellt die Literaturgeschichtsschreibung und die Literaturwissenschaft erneut vor grundsätzliche Fragen: Was verstehen wir unter dem Begriff der deutschen Literatur? Konfrontiert sind wir in diesem Fall mit der Problematik der Literatur von Einwanderern, ein Segment des literarischen Lebens, in den achtziger Jahren Gastarbeiterliteratur genannt, erlebt eine Neugeburt, geradezu eine Renaissance und grundlegende Veränderungen. Die jungen Migranten, der deutschen Sprache mächtig, währen sich gegen diese (und jede) Etikettierung, und verkünden, dass sie Teil der deutschen Literatur sind ebenso wie Kafka. Die Integrierungsversuche, die seit den achtziger, vielmehr jedoch seit den neunziger Jahren, gerade unter dem Begriff der interkulturellen oder transkulturellen Literatur laufen, sind also äußerst zweischneidig. Die Janusköpfigkeit unterstreicht auch Terézia Mora mit ihrer Bemerkung, wenn sie davon spricht, dass die Integration in die deutsche Literatur unter dieser Etikette eine „Ausgrenzung durch Anerkennung” sei. Dies zeigt, dass die Problematik eine prekäre Angelegenheit ist, egal von welcher Seite man sich nähert, und macht das Sprechen über dieses Segment der Literatur (fast) unmöglich.
Aus diesem Grund, um das Paradoxon umgehen zu können, nähere ich mich auch nicht allein aus der Perspektive der Fremdheit, zumindest verstehe ich Fremdheit nicht nur im Sinne von Migration, sondern spreche von einer allgemeinen Fremdheit, die man mit Lukács die „transzendentale Obdachlosigkeit” nennt, und die auf eine grundsätzliche Fremdheit des Menschen in der Sprache und in der Welt hinweist.[1]
Zweifelsohne können Moras und Tawadas Texte zum Beispiel auch im Kontext der sprachproblematisierenden Literatur situiert werden, so dass man die Biographie der Autorinnen außer Acht lässt. Die Fremdheit bedeutet in dieser Lesart dann eher die Unlesbarkeit der Welt, hier geht es nicht mehr um konkrete Länder und Grenzen, sondern vielmehr um die Wittgensteinschen oder Gadamerschen Grenzen; kurz, um die Schwierigkeiten und Grenzen von Erkenntnis. Diese Annäherung erscheint auch dann berechtigt, wenn man weiß, dass sowohl Mora als auch Tawada in ihren Texten mit Vorliebe Reisen, Unterwegssein, Fremdheit, das Ausland und zahlreiche ähnliche Themen anschneiden und ihre Figuren in diesem thematischen Motivgeflecht verorten. So geschieht das in Moras Roman Alle Tage[2], in dem der Protagonist, Abel Nema ein Fremder ist in einem Land, in dem er versucht, zu recht zu kommen. Weder sein Herkunftsland noch seine neue „Heimat” werden benannt: „Nennen wir die Zeit jetzt und den Ort hier. Beschreiben wir beide wie folgt. Eine Stadt, ein östlicher Bezirk davon. (...) Ein Samstagmorgen.” (9. Herv. im Orig.) In dieser Geste ist eine eindeutige Korrespondenz zu den Texten in Seltsame Materie[3], denn auch da geht es immer um „eine Stadt”, „ein Dorf”, „ein[en] See”, „eine Kirche” etc. Nemas Herkunftsort ist nur soweit beschreiben, dass es „eine Kleinstadt” ist in der „Nähe dreier Grenzen”, und sonst eine Insel, die anstatt eines Sumpfes entstanden ist (24). Es geht also um Grenzen im Allgemeinen, hinter denen sich das Fremde, Unbekannte, Geheimnisvolle, ja das Unheimliche verbirgt. Die zentrale Figur verlässt also diesen Ort, um sich anderswo, in einem anderen unbenannten Land, in einer anderen unbenannten Stadt niederzulassen.
Abel Nema versucht hier, seine Fremdheit damit zu eliminieren, dass er zehn Sprachen erlernt, die er dann ohne Akzent und ohne dialektalen Färbungen spricht. Diese Tatsache prägt ihm ein Habitus auf, als käme er nirgendwo her, als wäre er „ohne Ort” (13. Herv. im Orig.). Im Zentrum des ganzen Geschehens steht demnach die Sprache, oder vielmehr vielleicht eine Sprachlosigkeit, die trotz der zehn Sprachen das Dasein dieses Menschen dominiert. Das einzig Wichtige für Abel sind die Sprachen, alles Andere interessiert ihn nicht. „In der Welt zu sein und nicht in der Welt zu sein. So einer ist er”, ein Barbar (14). Die Hauptfigur scheint also jenseits einer absoluten Grenze zu existieren, die vielleicht die Grenze der Zivilisation ist. Dies bestimmt Nemas genuine Fremdheit.
Nema bedeutet, so wird das im Roman selber abgeleitet, der Stumme, und dieser sprechende Name weist zugleich auf das Paradoxon von Nemas Existenz hin. Stummheit ist jedoch bereits in Seltsame Materie, aber auch in Tawadas Texten ein zentrales Motiv. Obwohl Nema von seiner Umgebung nur „Zehnsprachenmensch” genannt wird, scheint er doch keine Sprache zu haben. Die Annäherung an die anderen Menschen und an die Welt bleiben ihm versagt, die Sprachen können dies nicht leisten, und seine Zunge, das Organ mit dem man auf eine andere Wese die Welt kennen lernen kann, ist beschädigt. Auch durch den Geschmacksinn kann er keinen richtigen Zugang zur Welt haben. Abel ist aber nicht nur stumm, sondern auch unsichtbar, nur ein Hauch, wie sein Name, Abel, im dem Hebräischen darauf verweist. Unsichtbarkeit und Sprachstörungen führen uns gleich zurück zu den Texten aus Seltsame Materie. Die Unsichtbarkeit entsteht auch hier aus einer Konturlosigkeit, aus der ständigen Verschiebung von Grenzen, aus einer fortwährenden unendlichen Bewegung. Das Fehlen eines Fixpunktes, einer Sicherheit, von etwas Bleibendem erscheint bereits in diesem Band, und ist mit dem Motivkomplex der Grenzüberschreitungen, der Schwimmbewegung, des fließenden Wassers gekoppelt, und wird überhaupt durch das Paradigma des Wassers greifbar. Hier schmilzt sogar das Asphalt, nicht nur das Wasser ist also fließend, auch der Weg, die Straße wird amorph und beweglich, das Teer ändert seine Form und klebt an den Füßen der Mädchenfigur.
Bewegung, Reisen und die unaufhörliche Änderung sind auch zentrale Elemente der Kunst Tawadas. Außer der Essaysammlung Talisman[4], die im vorigen Band vorgestellt wurde, thematisieren auch andere Schriften diesen Sachverhalt. Auch das „Kopfkissenbuch” Opium für Ovid[5], befasst sich, wie der Titel bereits nahe legt, mit der Änderung. Dieses Buch impliziert mehrere Grenzverschiebungen und -überschreitungen zugleich, indem es das östliche Opium mit einem Repräsentanten der westlichen Zivilisation, Ovidius Naso verbindet, und darüber hinaus auf Ovids Metamorphosen anspielt, die das Paradigma der Änderung par excellence darstellen. Tawadas Ovid-Buch erzählt mit zahlreichen Korrespondenzen mit dem Vorgänger das Schicksal von zweiundzwanzig mythischen Frauenfiguren. Das Erzählen geschieht mit einer, der Trance des Opiums gehorchenden Logik, in einem Assoziationsgeflecht, das einen multiperspektivischen, polyphonen Text hergibt. Das Ganze ist gleichzeitig ein Spiel mit der Sprache, mit Neologismen, ungewöhnten Komposita, die mit ihrem bizarren Nebeneinander neue Konstellationen der Sprache und der Welt zustande bringen. Grenzen verschwinden, der ganze Text artet zu einem einzigartigen Sprachfluss aus.
Der intertextuelle Verweis auf die Metamorphosen ist kein Zufall, denn die störenden, aber in diesem Denken selbstverständlichen Mutationen sind zentrale Pfeiler der Schriften Tawadas. Es überrascht also nicht, dass die Autorin auch ihrer Tübinger Poetik-Dozentur den Titel Verwandlungen[6] gab. Die Bewegung, die Veränderung der Form sind konstante Elemente ihrer Kunst, die auch die Grenzen des Ich modifizieren und sogar zum verschwinden bringen. Auch diese Änderungen hängen hauptsächlich mit dem Wasser zusammen. Aus Das Bad[7] erfahren wir, dass sich unser Körper, da er zum Großteil aus Wasser besteht, ständig ändert. Immer, wann und wenn auch immer wir in den Spiegel sehen, haben wir ein anderes, ein neues Gesicht vor uns. Bleibende, gleiche Konturen gibt es nicht. Die geläufigen Konstruktionen der Identität schwinden, sie werden vehement hinterfragt. So Mora wie Tawada haben meines Erachtens im Auge und zum Ziel, unsere Ich- und Weltkonstruktionen zu überprüfen, die Falschheit dieser zu beleuchten. Alles ist amorph, auch die Welt schwimmt, wie in Das Bad, eigentlich auf einem Ozean, und die Stadt steht, wie in Alle Tage oder in Seltsame Materie auf Sumpf oder Wasser. Das richtige Element der Figuren ist das Wasser, das ist ihnen wesenhaft, nur darin fühlen sie sich wohl.
Parallel dazu, wie die Figuren im Wasser untertauchen, so tauchen sie auch in die Bewegungen der Sprache ein und in ihnen ab. Das Fließende bringt auch die kulturellen Codes zum Oszillieren, alles scheint sich in einem anderen Register zu bewegen. Die Erzählstrategie bevorzugt, um das Paradigma des Fließenden noch zu unterstreichen die Form des Essays. Alles wird zu einer Reise durch Städte, Länder und Sprachen, zu einer labyrinthischen Bewegung. Mit den intertextuellen Verweisen werden auch die Grenzen der Texte angegriffen, auch die werden beweglich, sind nicht mehr fest zu ziehen. Das Kommando übernimmt auf allen Ebenen die Bewegung der Sprache.
Die Auflösung der Grenzen wird bei beiden Autorinnen mit den zahlreichen Zwischen-Zuständen betont, die in Form von Traum, Trance, Halluzination, Rausch u.ä.m. erscheinen. Die Wahrnehmung ist getrübt, alles ist verschwommen und steht auf dem Kopf. Das Gewöhnliche wird umgedreht, eine Fremdheit wird inszeniert, die ständig auf das Dasein von Verwandlungen hinweist. Die Automatismen der Wahrnehmung und nicht zuletzt der Sprache werden dabei hinterfragt, das Verfestigte wird fließend, wie der Asphalt in Der Fall Ophelia[8].
Die Bücher aus dem Niemandsland führen uns in eine Welt, in der es keine Namen, Wörter und Bedeutungen gibt, dorthin, wo alles hinterfragt wird. In dieser Zwischenwelt, nennen wir es Grenzdasein, gewinnt eine genuine Wahrnehmung an Gewicht, eine andere, nur hier mögliche Sprache. Die hier anvisierten Texte von Mora und Tawada führen uns mit einer Abenteuerreise in unseren eigentlichen Alltag, zur Reise setzen sie uns jedoch eine neue Brille auf die Nase, damit in unserer Sicht ein Bruch entsteht. Dies soll uns daran erinnern, dass zwischen uns und der Welt etwas ist, und soll darauf verweisen, dass unsere bekannte Weltsicht trügerisch ist. „Das Leben ohne Brille ist langweilig” – sagt Coronis in Opium für Ovid, als sie beim Optiker mehrere Brillen ausprobiert, und setzt fort: „Ich sehe immer etwas anderes. Zufolge häufigen Brillenwechsels Mehrdeutigkeit erleben, soll das der Sinn von Brille sein?” [1]Zum Verfassen meines Aufsatzes habe ich folgende Bücher benutzt: Mansbrügge, A.: Junge deutschsprachige Literatur. Berlin, Cornelsen, 2005. Blioumi, A. (Hg.): Migration und Interkulturalität in neueren literarischen Texten. München, Iudicium, 2002. Chiellino, C. (Hg.): Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch, Stuttgart, Metzler, 2000. Amodeo, I.: 'Die Heimat heißt Babylon'. Zur Literatur ausländischer Autoren in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1996. Esselborn, K.: Von der Gastarbeiterliteratur zur Literatur der Interkulturalität. Zum Wandel des Blicks auf die Literatur kultureller Minderheiten in Deutschland, In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Intercultural German Stadies (23). München, Iudicium, 1997, 47. Weigel, S.: Literatur der Fremde – Literatur in der Fremde, In: Grimminger, R. (Hg.): Hausers sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart (12). München, 1992, 182�. [2] Alle Tag., Luchterhand Verlag, München, 2004. [3] Seltsame Materie. Erzählungen, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1999. [4] Talisman. Tübingen, Konkursbuchverlag, 1996. [5] Opium für Ovid. Ein Kopfkissenbuch von 22 Frauen. Tübingen. Konkursbuch Verlag, 2000. [6] Verwandlungen. Tübinger Poetik-Dozentur. Tübingen, Konkursbuchverlag, 1998. [7] Das Bad. Tübingen, Konkursbuhverlag, 1989. [8] Der Fall Ophelia. In: Seltsame Materie. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1999. |
||
|
Kiadványunk felsõoktatási segédanyag, mely A Pécs / Sopiane Örökség Kht,a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Klebelsberg Kunó Emlékére” Szakalapítványa,valamint A Pécs2010 Programtanács „Európa Kulturális Fõvárosa - 2010” cím elérésére kiírt pályázatán megítélt Nívódíj segítségével, a kiadványhoz kötõdõ konferencia pedig a Pécsi Tudományegyetem Rektora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, a magyar szakos levelezõ képzés és a Liber-Arte Alapítvány által nyújtott támogatásokkal jöhetett csak létre. Segítségükért ezúton is köszönetet mondunk. |
||
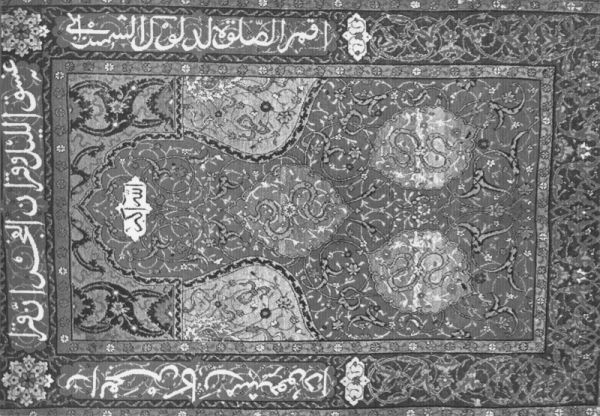 Erika Hammer
Erika Hammer